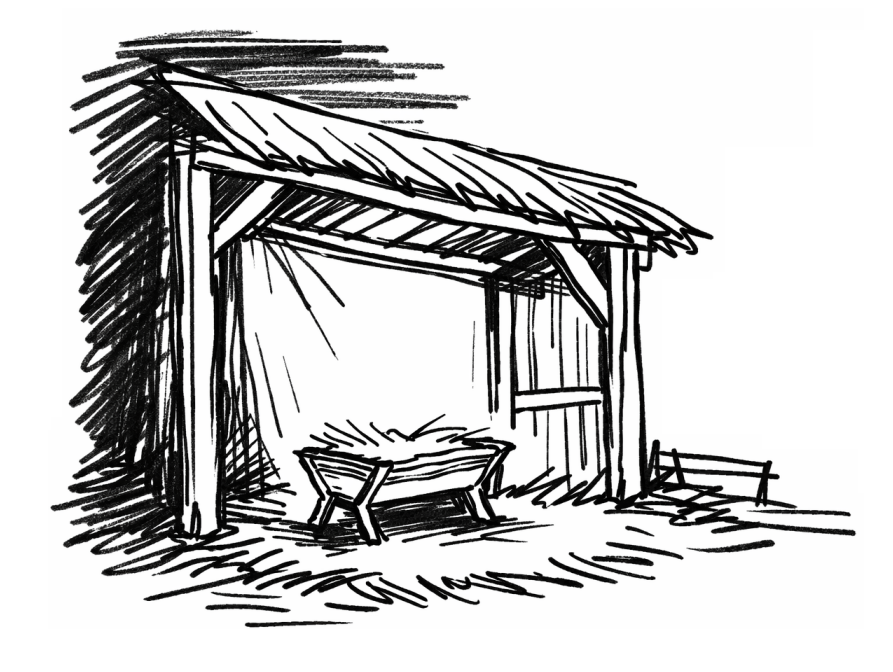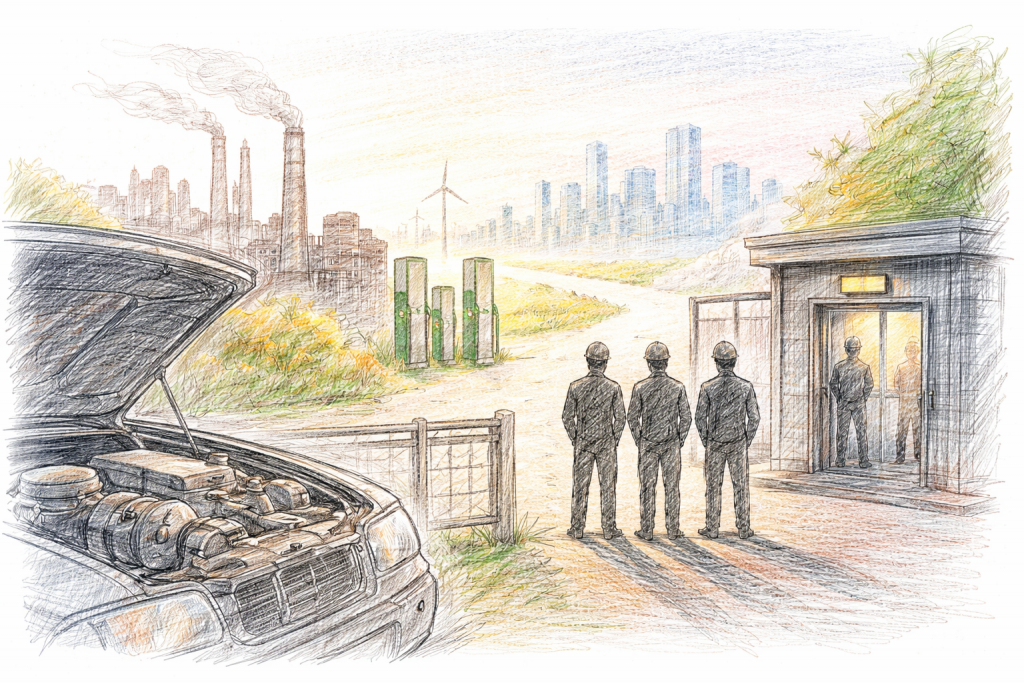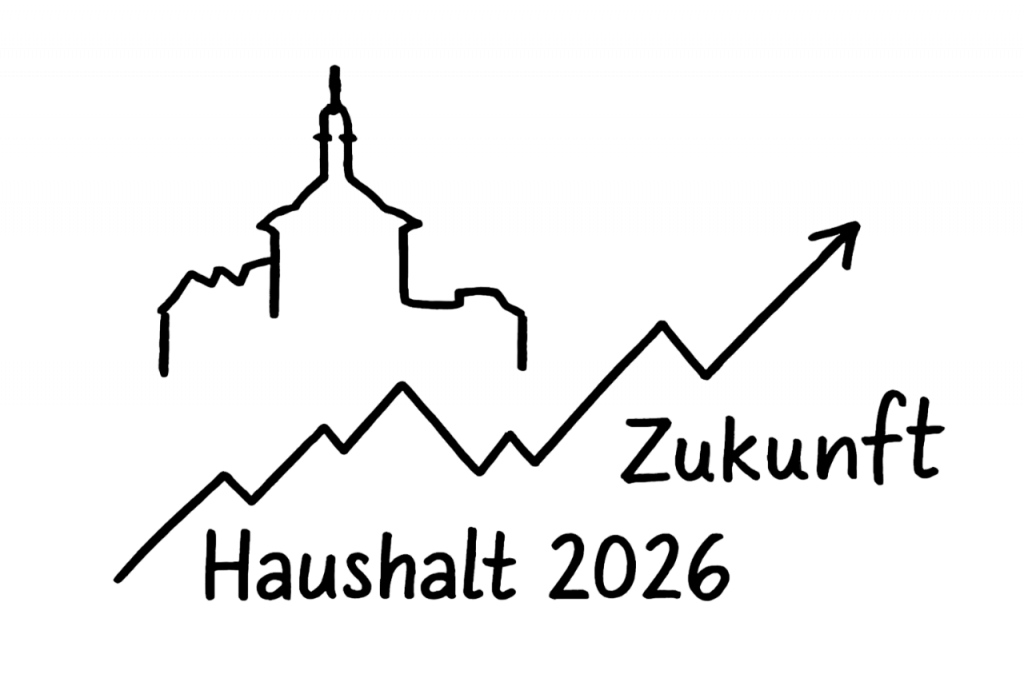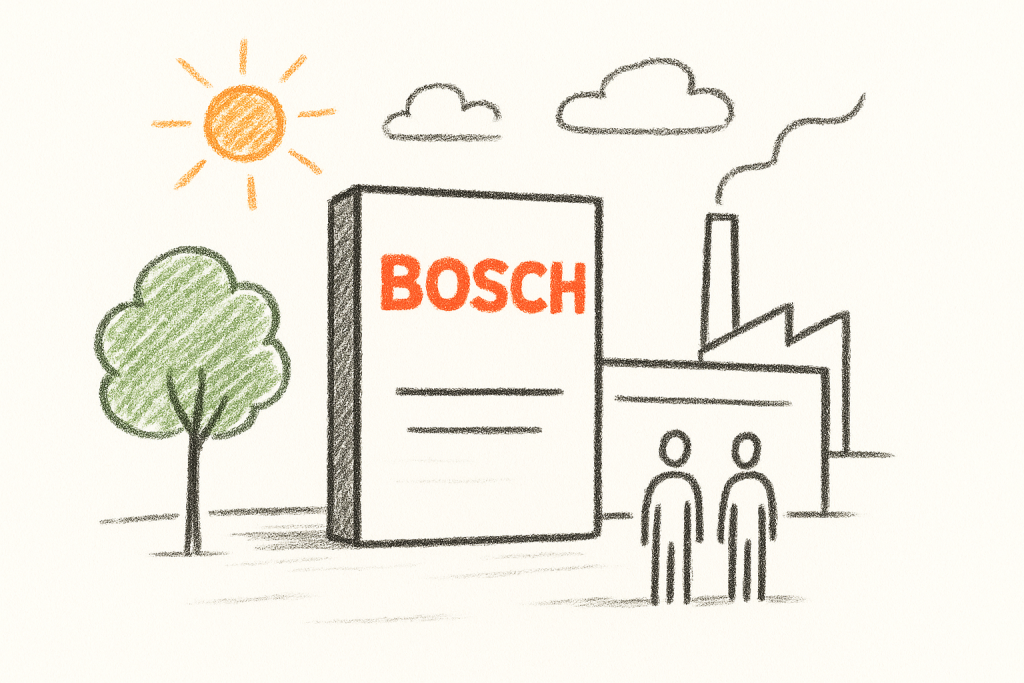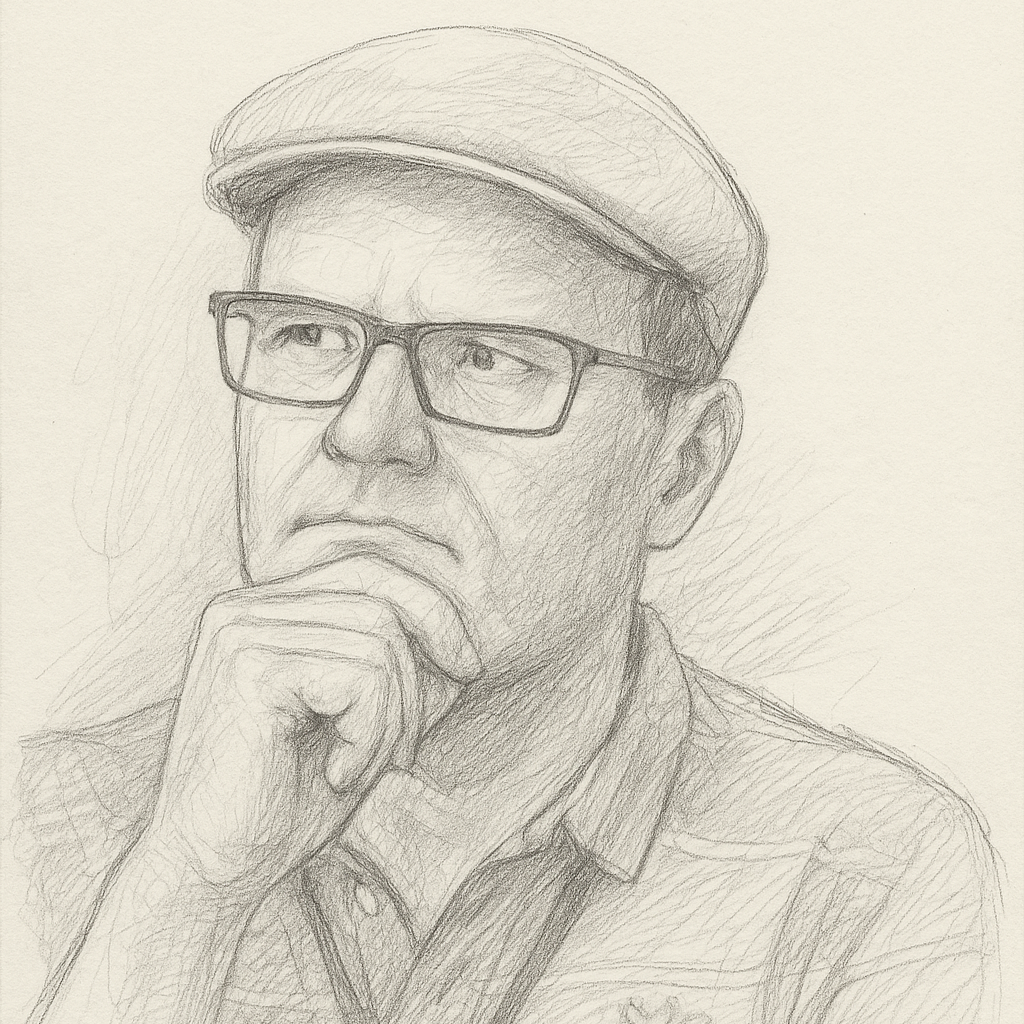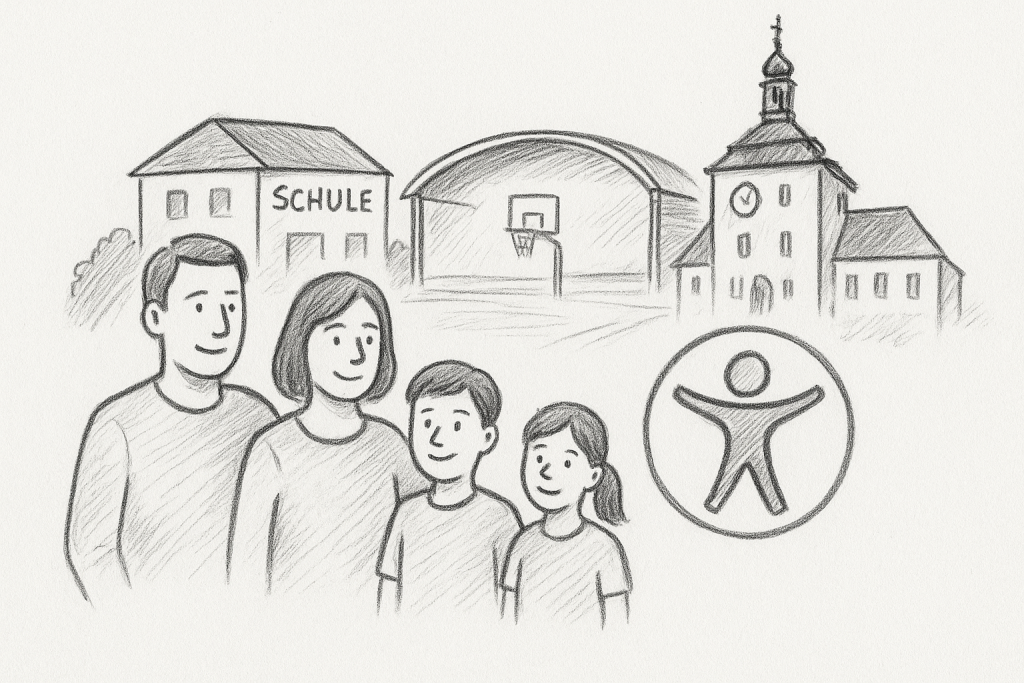Zwischen Bericht und Realität: Hinter den Zahlen stehen Menschen
Manchmal reden wir über Sozialpolitik, als ginge es nur um Zahlen. Aber hinter jeder Zahl steckt ein Mensch.
Eine Familie, die auf einen Kitaplatz wartet.
Ein älterer Mensch, der nicht mehr alles allein schafft.
Ein Jugendlicher, der jemanden braucht, der zuhört.

Mit diesem Gedanken habe ich den Sozialbericht der Stadt Bamberg für die Jahre 2020 bis 2025 gelesen. Und ich sage ehrlich: Dieser Bericht lässt mich nicht kalt.
Er zeigt, dass in den letzten Jahren viel geleistet wurde – trotz Corona, Krieg, steigender Preise und Personalmangel. Mehr Kita-Plätze, mehr Angebote für Jugendliche, neue Quartiersarbeit, bessere Unterstützung in Pflege und Inklusion. Das ist gut. Und das darf man auch sagen.
Aber der Bericht zeigt genauso deutlich: Die Aufgaben wachsen schneller als die Möglichkeiten. Und genau da beginnt für mich Verantwortung.
Kinder und Familien sind für mich nicht verhandelbar
Ich bin fest davon überzeugt: Wer bei Kindern und Familien spart, spart an der Zukunft. Frühkindliche Bildung ist keine nette Zusatzleistung. Sie ist die Grundlage dafür, dass Menschen später ihren Weg gehen können.
Der Sozialbericht zeigt klar, wie stark der Bedarf gestiegen ist. Mehr Kinder in Betreuung, mehr Unterstützung für Familien, mehr Druck im Alltag. Für mich heißt das: Genau hier müssen wir dranbleiben. Nicht nur mit guten Worten, sondern mit klaren Entscheidungen.
Teilhabe darf kein Zufall sein
Ob Jugendbeteiligung, Inklusion oder Quartiersarbeit – der Bericht zeigt: Teilhabe funktioniert, wenn man sie ernst meint. Sie entsteht nicht von allein. Sie braucht Strukturen, Personal und den Willen, Menschen mitzunehmen.
Ich will in einer Stadt leben, in der Teilhabe nicht davon abhängt, wie gut jemand sich auskennt oder wie laut er ist. Sondern davon, ob wir es als Gemeinschaft wirklich wollen.
Soziales ist kein Luxus
Die Sozialausgaben sind stark gestiegen. Manche sehen darin ein Problem. Ich sehe darin vor allem Realität. Mehr ältere Menschen, steigende Mieten, mehr Pflegebedarf, mehr Belastung für Familien und Jugendliche.
Soziale Infrastruktur ist kein Extraservice. Sie hält unsere Stadt zusammen. Wer hier kürzt, spart nicht – er verschiebt Probleme in die Zukunft.
Was jetzt folgen muss
Für mich ist klar: Wir müssen Prioritäten setzen. Nicht alles geht gleichzeitig. Aber Bildung, Familie, Pflege und Wohnen müssen abgesichert bleiben.
Wir brauchen Ehrlichkeit. Wenn Bund und Land Aufgaben an die Kommunen weitergeben, müssen sie auch die Mittel mitgeben. Alles andere ist unfair.
Und wir müssen die Menschen ernst nehmen, die das alles möglich machen: Fachkräfte in sozialen Berufen, freie Träger, Ehrenamtliche. Ohne sie funktioniert kein Sozialbericht, keine Strategie, keine Stadt.
Warum ich mich dazu äußere
Ich schreibe das nicht, weil ich alles besser weiß. Sondern weil ich Verantwortung spüre. Für die Stadt, in der ich lebe. Für den Zusammenhalt, der nicht von allein entsteht.
Der Sozialbericht ist für mich kein Abschluss. Er ist ein Auftrag.
Und hinter jeder Zahl steht ein Mensch. Das dürfen wir nicht vergessen.